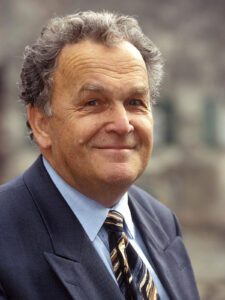Artikel teilen:
Bauernland soll Bauernland bleiben
Der Boden ist in der engen Schweiz ein knappes Gut. Entsprechend gross ist der Konkurrenzkampf, wenn es darum geht, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu befriedigen: den Siedlungsbau, die Verkehrsanlagen, die landwirtschaftliche Produktion, den Naturschutz, die Erholung und die Erzeugung erneuerbarer Energie. Dabei geraten die Landwirtschaftszonen zunehmend unter Druck.
Von Vera Bueller / 1. März 2019
1.12.2017. Von Bellinzona herkommend führt die Strasse vorbei an unzähligen Gewerbegebäuden, Tankstellen, grösseren und kleineren Einkaufszentren, Baumärkten, Möbelhäusern, ab und zu ein Stück Grün, immer wieder Abzweigungen zu benachbarten Industriezonen. Nach Quartino in Richtung Locarno folgen dann links und rechts ehemalige Ackerflächen mit grossen Glasgewächs- und Tunnel-Treibhäusern.
Kaum vorstellbar, dass dieser Talgrund einst von vielen kleinen Wasseradern durchzogen war, gespeist von den Bächen, die sich aus den Seitentälern in die Ebene ergossen. Heute erinnert daran nur noch die im Mündungsdelta am Lago Maggiore gelegene «Bolle di Magadino» – die zu einer geschützten Moorlandschaft mit zahlreichen Tümpeln, Schilfgürteln und einer artenreichen Tierwelt gehört. Mit den Korrektionen des Flusses Ticino wurde nämlich das einstige Überschwemmungs- und Sumpfgebiet Stück für Stück trockengelegt und landwirtschaftlich genutzt. Doch die Veränderungen gingen weiter: War die Magadinoebene Mitte des 20. Jahrhunderts noch die fruchtbare Kornkammer des Kantons, entwickelte sie sich ab den 1970er-Jahren immer mehr zum Standort für Gewerbe, Industrie und Logistik mit Strassen und Verkehrsknotenpunkten – ohne erkennbare Ordnung. Wertvolles Kulturland ging verloren.
Die Magadinoebene zwischen Bellinzona und Locarno ist ein Negativbeispiel für Zersiedelung und fehlgeschlagene Raumplanung. In den letzten Jahren hat jedoch ein Umdenken stattgefunden: Das Tessiner Parlament hat 2014 beschlossen, die verbliebenen Grün- und Ackerzonen entlang des Ticinos als Naherholungsgebiet zu retten und 2350 Hektaren in einen Park umzuwandeln. Dazu gehören Auenwälder, Feucht- und Moorgebiete (24%), Landwirtschaftsflächen (66%) sowie Verkehrswege und verschiedene Bauten. Mit Hilfe eines speziellen kantonalen Nutzungsplans für den «Parco del piano di Magadino» soll eine Landschaft entstehen, in der die Bedürfnisse von Landwirtschaft, Natur und Erholungssuchenden koordiniert und Synergien genutzt werden.
Es sind nicht alle enthusiastisch
Konkrete Projekte für eine Aufwertung der Landschaft liegen vor – etwa der Rückbau störender Infrastruktur, Bepflanzungen, Neuordnung elektrischer Leitungen, eine bessere Gestaltung des Übergangs zur Industriezone. Einfach ist die Umsetzung nicht und «es sind nicht alle betroffenen Grundeigentümer und Gemeinden enthusiastisch», bemerkt Giacomo Zanini, der Präsident der Stiftung Parco del piano di Magadino. So diskutiere man beispielsweise über die Beseitigung von Bauten, die noch vor Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes von 1980 entstanden sind. Oder von solchen, die später illegal erstellt wurden. Das Hauptproblem bestehen jedoch darin, «dass die Landwirte expandieren wollen und grössere, fast schon industriell anmutende Anlagen für die Produktion von Gemüse und Früchten aufstellen möchten. Da prallen die Welten von Ökonomie und Ökologie aufeinander.»
Damit spiegelt sich in der Magadinoebene im Kleinen wider, was in der ganzen Schweiz zu Konflikten führt, wenn es um die Nutzung von Gebieten ausserhalb der Bauzonen geht: Es konkurrenzieren sich die verschiedensten Ansprüche der Landwirtschaft, der Gesellschaft und des Naturschutzes auf begrenztem Raum.
Bereits heute befinden sich fast 40 Prozent der Schweizer Siedlungsfläche in Nichtbaugebieten. Wobei Auto- und Eisenbahnen, Überlandstrassen sowie ein in der Schweiz vergleichsweise feinmaschiges Netz von landwirtschaftlichen Erschliessungsstrassen einen grossen Anteil ausmachen. Im Zentrum der Interessengegensätze stehen jedoch die Landwirtschaftszonen, die gemäss Raumplanungsgesetz eigentlich von Überbauungen weitgehend freigehalten werden sollten. Denn sie dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich.
Doch zwischen dem hehren Prinzip und der Realität klafft eine gewaltige Lücke: Das Programm Landschaftsbeobachtung Schweiz LABES, das seit 2007 den Zustand der Landschaft erfasst, stellt der Schweiz in seinem neusten Bericht 2017* ein trauriges Zeugnis aus. Es sei bislang nicht gelungen, den quantitativen Verlust von landwirtschaftlichem Kulturland zu stoppen. Und Erhebungen aus dem Kanton Aargau zeigen, dass dort 60 Prozent des im Jahr 2014 verbuchten Verlusts an Fruchtfolgeflächen auf den Bau von Remisen, Masthallen, Ställen, Silos und anderen landwirtschaftlichen Anlagen zurückzuführen sind.
Reto Camenzind von der Sektion Siedlung und Landschaft beim Bundesamt für Raumplanung (ARE) bestätigt, dass auch Zahlen des Bundes (Arealstatitik) auf eine Zunahme des Bodenverbrauches durch die Landwirtschaft hinweisen. «Die neusten Entwicklungen sind darin aber noch nicht enthalten. Zudem sind die Zahlen des Bundes im Vergleich zu Kantonen viel weniger detailliert.»
Bedeutung der Landschaft nicht zu unterschätzen
Nebst Veränderungen an den landwirtschaftlichen Wohnbauten, die heutigen Komfortansprüchen angepasst und mit Stöckli-Bauten ergänzt werden, sind es vor allem die Vergrösserungen der Stallbauten als Folge von Betriebszusammenlegungen und Anpassungen an moderne Tierhaltungskonzepte, die das Landschaftsbild erheblich veränderten. Meist sind diese Bauten in der Landwirtschaftszone. Sie sind es dann, wenn sie für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung erforderlich sind. Dennoch müsste bei der Standortwahl eine umfassende Interessenabwägung vorgenommen und dem raumplanerischen Prinzip der Konzentration von Bauten Rechnung getragen werden. Das hat auch das Bundesgericht entschieden: Neubauten sollten am bestehenden Hof angelagert und nicht in die freie Landschaft gestellt werden. «Denn die Bedeutung einer intakten Landschaft für die Gesellschaft darf man nicht unterschätzen. Es geht um Identität, Erholung, Ästhetik und auch um einen wichtigen Standortfaktor, für den Tourismus wie überhaupt für die Wissensökonomie der Schweiz. Die Möblierung der offenen Landschaft mit Seilbahnen, Grossställen und Masthallen, mit Windrädern, Strassen und Stromleitungen muss unbedingt nachhaltig geregelt werden: Der regionale Landschaftscharakter soll erhalten bleiben», sagt Daniel Arn, der in der Sektion Ländlicher Raum des BAFU für die Landschaftspolitik zuständig ist.
Die Umsetzung dieses Nachhaltigkeitsgedankens ist im Alltag eines Bauern allerdings nicht einfach. «Die Landwirte befinden sich in einem riesigen Dilemma. Sie müssen innovativ und wettbewerbsfähig sein um zu überleben, brauchen Entfaltungsmöglichkeiten. Gleichzeitig verlangt man von ihnen, die Umwelt zu schonen, die Fruchtfolgeflächen zu erhalten, den Tierschutz zu beachten, die Landschaft zu pflegen und Immissionen zu vermeiden», gibt Thomas Hersche vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) zu bedenken. «Wir vom BLW sind der Meinung, dass bei jedem Bauvorhaben auf regionale Eigenheiten geachtet sowie die Qualität des Bodens bewertet werden sollte. Und wenn gebaut werden muss, dann möglichst nicht auf Fruchtfolgeflächen und in einer ansprechenden Qualität.»
Zumal der Standort mitten auf einer Wiese – etwa für eine neue Halle für die rentable Pouletmast – den Bau von Zufahrten und grossen Wendeplätzen für Dreiachser nach sich zieht. Da stellt sich durchaus die Frage, ob angesichts der Dimensionen derartige Anlagen nicht eher in eine Gewerbe- oder Industriezone gehören, zumal das Futter, das verfüttert wird, oft zugekauft wird. Thomas Hersche würde sich wünschen, dass Anlagen für neuartige Geschäftsmodelle, wie die Insekten-, Pilz- oder Fischzucht nicht über die Landwirtschaftszone verteilt, sondern besser konzentriert in einer eigens dafür geschaffenen Speziallandwirtschaftszone zu liegen kämen oder dass dafür bestehende Gebäude umgenutzt würden.
«Ideal wäre ein Produktionsmodell, das bodenabhängig ist », bringt es Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung für Landschaftsschutz auf den Punkt. Er verlangt die Schaffung eigentlicher landwirtschaftlicher Industriezonen. Dass Bauten ausserhalb der Bauzone oft mit tierschützerischen und umweltrechtlichen Auflagen – wie Abstandsvorschriften zu Wohnhäusern oder anderen Produktionsstätten – begründet werden, lässt er nicht gelten: «Es ist ein No-Go, die Raumplanung aushebeln zu wollen mit Umweltschutzargumenten.»
Trennung von Bau- und Nichtbauzonen ist oberstes Gebot
Die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet ist einer der fundamentalen Grundsätze der Raumplanung in der Schweiz. «Daran darf man nicht rütteln», betont Daniel Arn. «Im Nichtbaugebiet soll grösste Zurückhaltung für neue Bauten gelten. Die dennoch erstellten sollen den regionalen Landschaftscharakter berücksichtigen und sich gut in die Landschaft eingliedern.» Allerdings wurde das Gebot der Trennung zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet im Laufe der Zeit arg strapaziert und immer löchriger – nicht zuletzt auf Druck diverser parlamentarischer Vorstösse. Gab es bei Inkrafttreten des Gesetzes 1980 zum Bauen ausserhalb der Bauzone noch einen einzigen Artikel, so sind es heute sieben mit unzähligen Absätzen und Präzisierungen in der Verordnung.
Auch Raimund Rodewald verweist auf die «Extrazügli mit Ausnahmen von Ausnahmen. Mal war es die Produktion von Energie aus Biomasse, mal die Aufbereitung von landwirtschaftlichen Produkten, dann die Umnutzung von landschaftsprägenden Bauten und zuletzt die hobbymässige Kleintierhaltung, die alle eine eigene Sonderregelung im Gesetz erheischten. Was im Einzelfall durchaus sinnvoll sein kann und kaum Störungen verursacht, wird zum landschaftszerstörenden Problem, wenn es überall erlaubt ist und sich tausendfach repetiert.»
Was die zweite Revisionsetappe des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes bringen wird, ist offen. Sowohl beim Bafu, wie beim BLW und dem ARE ist man sich jedoch einig, wohin der Weg führen sollte: Unnütz gewordene Gebäude und Anlagen, die nicht positiv zum Charakter der Landschaft beitragen, müssen zurückgebaut und nur tatsächlich standortgebundene Bauten dürfen zweckgebunden ausserhalb der Bauzone erstellt werden.
Thomas Hersche gibt allerdings zu bedenken, dass man grossflächiger denken müsste: Punktuell könne man zwar etwas erreichen, «aber wenn es darum geht, die Interessen von Grundeigentümern, Landwirten, Gemeinden und Organisationen unter einen Hut zu bringen, müsste eine regionale Planung angegangen werden» Vielleicht haben die Tessiner in der Magadinoeben den Weg vorgezeichnet. Raimund Rodewald ist jedenfalls voll des Lobes: «Das Projekt ist mehr als eine raumplanerische Anordnung, weil es die Bedürfnisse eines gewaltigen Ballungsgebietes berücksichtigt. Und die Trägerschaft des Projekts ist breit abgestützt. Wenn man hier keine gute Lösung findet, weiss ich auch nicht mehr weiter.»