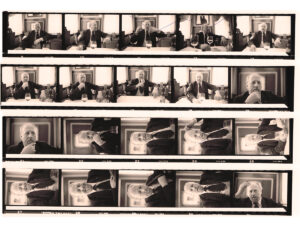Artikel teilen:
Berühmte Atheistinnen: Simone de Beauvoir
Die 1908 geborene Simone de Beauvoir schockierte zu Lebzeiten ihre gutbürgerliche Umwelt durch ihren Atheismus, ihre freie Verbindung mit dem Philosophen Jean-Paul Sartre – und ihre feministische Studie «Das andere Geschlecht».
Von Vera Bueller / 3. Oktober 2021
Am Ende ihres Lebens stellte Simone de Beauvoir fest, dass sich zwar viele ihrer philosophischen Ideen im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt hätten, ihr Atheismus aber unbeirrbar geblieben sei. Sie war der festen Überzeugung, dass die Dogmen der Religion das kritische Denken und die analytische Argumentation ausschliessen, die für die Entwicklung des menschlichen Denkens notwendig sei. Beauvoir schrieb: «Der Glaube ist oft ein Anhängsel, das in der Kindheit als Teil der bürgerlichen Ausstattung gegeben wird.» Wenn ein Zweifel aufkomme, werde er oft aus emotionalen Gründen beiseitegeschoben ? aus nostalgischer Treue zur Vergangenheit, aus Zuneigung zu den Menschen um einen herum, aus Furcht vor der Einsamkeit und Verbannung.
Auf dem Weg zur Nonne
Sie schrieb dies aus eigener Erfahrung: Aufgewachsen in einem gutbürgerlichen Elternhaus mit eigenem Dienstmädchen und ausgeprägtem Klassenbewusstsein, besuchte sie eine katholische Privatschule, wo sie auf die Rolle als gebildet-distinguierte Ehefrau und Mutter oder als Nonne vorbereitet werden sollte. Ihr Vater Georges belächelte zwar die Gläubigkeit in der Gesellschaft, hiess sie aber trotzdem gut: Religion, fand er, sei eine Sache für Frauen und Kinder.
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Intellektuellen war dabei der Verlust ihres katholischen Glaubens ? im Alter von 14 Jahren: Auf der Suche nach Antworten auf die grossen Fragen des Lebens wandte sie sich der Philosophie zu. In der katholischen Schule wurde sie als ein Opfer des Teufels betrachtet, als sie sich zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Baccalaureats (das sie vor einer Kommission in der Sorbonne ablegte) entschloss, das Lehramt im Fach Philosophie an staatlichen, also laizistischen Gymnasien anzustreben.
Der «Pakt»
An der Sorbonne lernte sie im Frühjahr 1929 Jean-Paul Sartre kennen. Aus den beiden wurde ein Paar ? eine Verbindung, die 51 Jahre währte. Berühmt wurde deren «Pakt», den sie im Oktober 1929 schlossen: Ihre Liebe sei «nur» eine «amour nécessaire». Ihr Zusammensein basiere auf Freiheit und richte sich gegen die traditionell-bürgerlichen Beziehungsmodelle. «Was zählt, ist allein die individuelle Freiheit», so das Credo nach den Grundsätzen des Existenzialismus.
In ihren Werken behandelte de Beauvoir denn auch stets Themen und Fragen, die sie persönlich betrafen und berührten. Berühmt wurde sie dann vor allem für das Werk «Das andere Geschlecht» ?
oder eher: berühmt-berüchtigt. In der durch den Katholizismus geprägten Gesellschaft galt das Buch als skandalös. Damals, 1949, waren Schwangerschaftsabbrüche und Verhütungsmittel illegal, die Regierung betrieb eine Politik der aktiven Geburtenförderung ? die traditionelle Familie war das gesellschaftliche Ideal.
Keine Feministin?
Obwohl Beauvoir mit «Das andere Geschlecht» einen feministischen Klassiker schrieb, sah sie sich in jener Zeit selbst nicht als Feministin. Das lag vor allem daran, dass sie Sozialistin war und glaubte, eine Transformation des kapitalistischen Systems ? und damit verbunden die Auflösung des Klassenwiderspruchs ? würde automatisch die Befreiung der Frau mit sich bringen.
Als Simone de Beauvoir am 14. April 1986 starb, wurde sie dennoch in zahlreichen Nachrufen der linken Presse als feministisches Vorbild gefeiert, der berühmte Satz: «Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es», wurde überall zitiert. Mindestens ebenso wichtig wie Beauvoirs Theorien zum Geschlechterverhältnis war und bleibt aber für viele die Art und Weise, wie sie lebte.